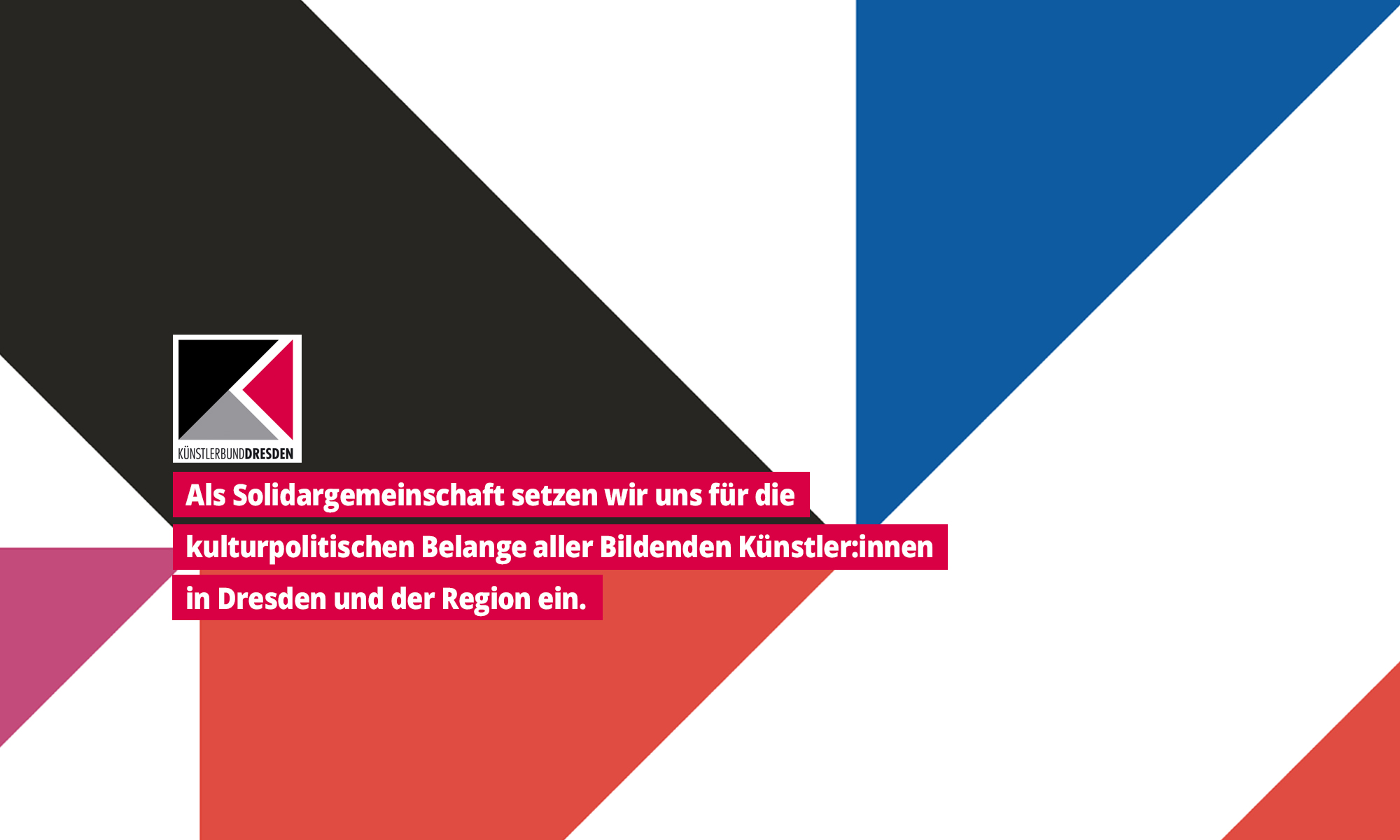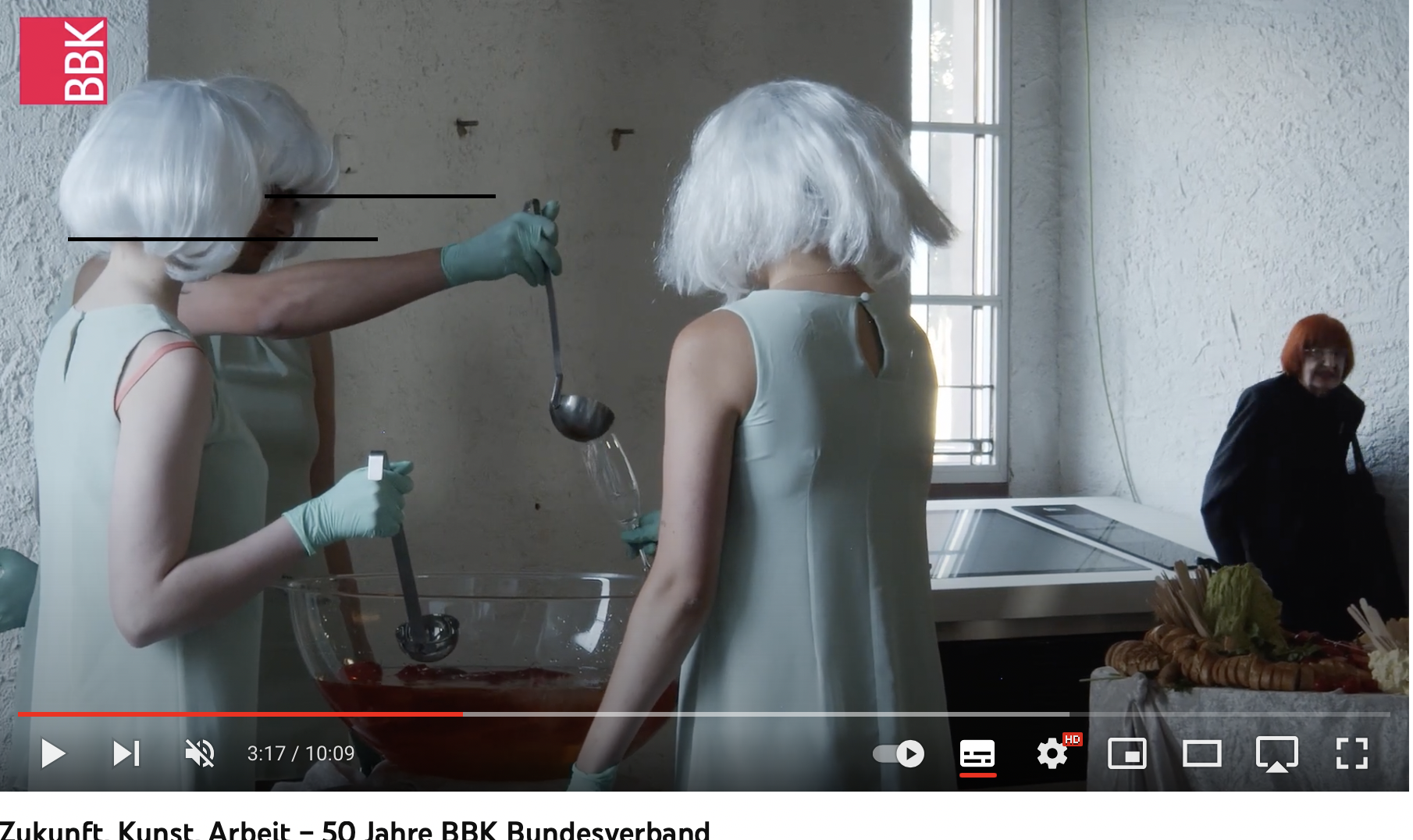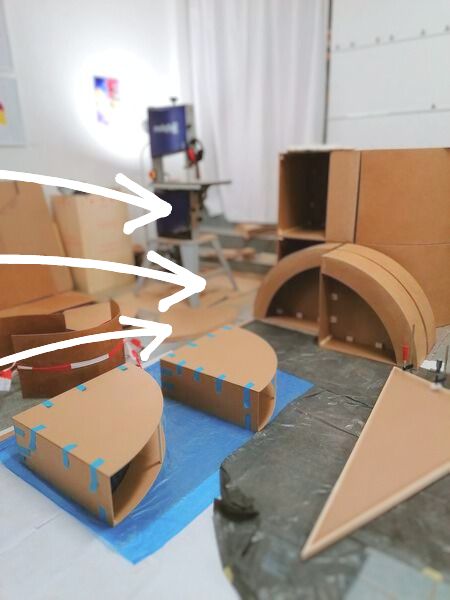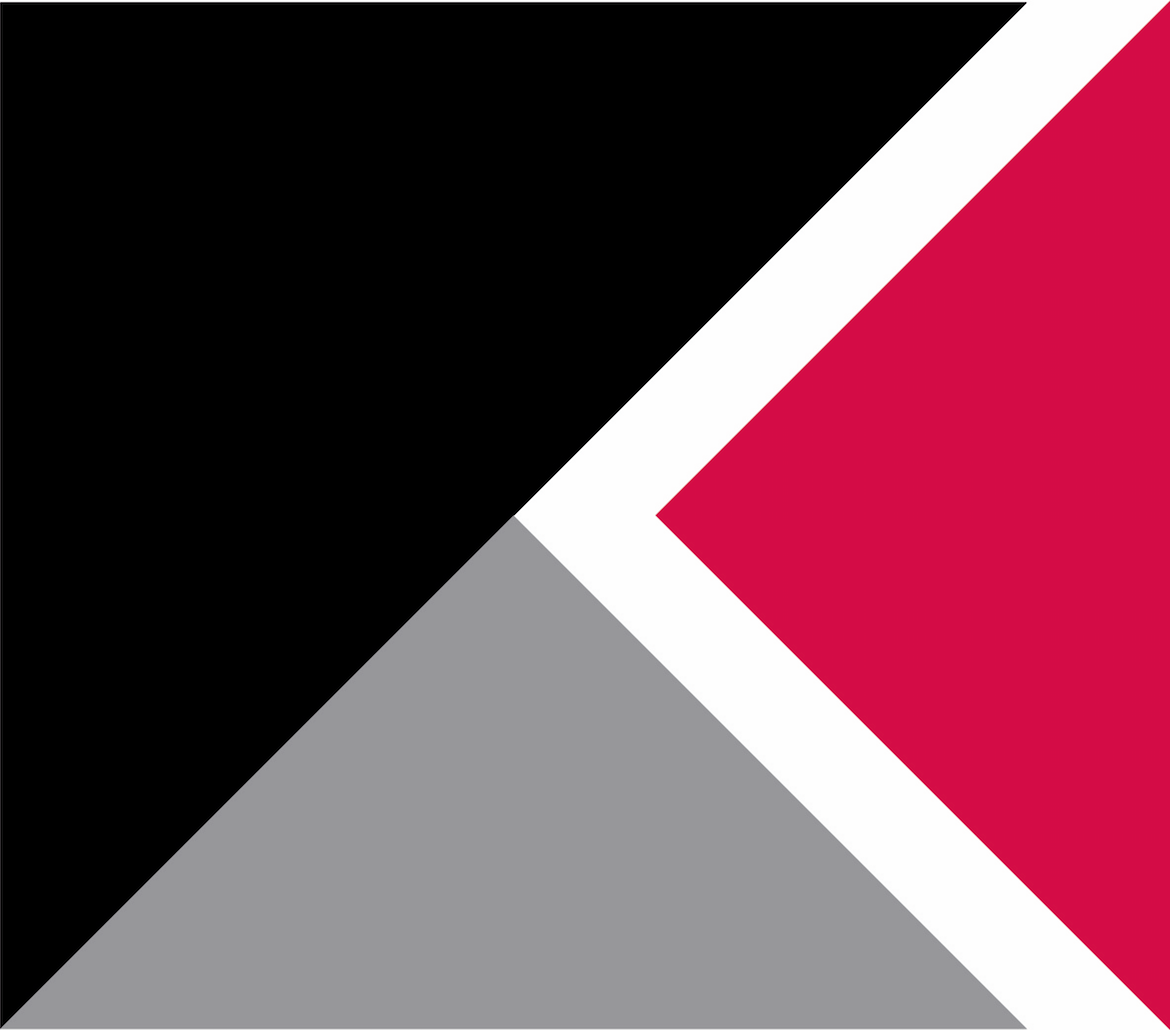Nazanin Zandi ist mit einem der beiden diesjährigen Förderpreise der Landeshauptstadt Dresden ausgezeichnet. Aus sechs Monaten Aufenthalt während ihres Studiums sind inzwischen 27 Jahre geworden. Mit uns spricht sie über das, was sie aktuell am meisten umtreibt.
KBD: Herzlichen Glückwunsch zum Förderpreis, liebe Nazanin. In der Erklärung der Jury wird insbesondere betont, dass du Text und Bild nutzt, um marginalisierte Stimmen sicht- und hörbar zu machen.
NZ: Auf unterschiedliche Weise. Früher habe ich sehr viel gemalt und dort auch Schrift und Bild verbunden. Außerdem bin ich seit meiner Kindheit ein großer Fan von Comics und Graphic Novels, auch weil mein bester Freund in Italien eine große Sammlung und viel Wissen hatte.
Langezeit spielte das keine große Rolle mehr in meinem Leben, bis es dann für das Projekt „Stimmen“ wichtig wurde.
KBD: Wir haben bei den vergangenen Interkulturellen Tagen das Buch*, das ein Produkt dieses Projekts ist, mit in unserer Mitgliederausstellung gezeigt. Magst du zum Hintergrund etwas mehr erzählen?
NZ: Elena Pagel und ich haben jahrelang Kurse für Geflüchtete gegeben, an unterschiedlichen Orten in Dresden, und dabei ausschließlich Männer dabeigehabt. So kam es 2018 zu der Idee, auch Frauen zu Wort kommen zu lassen. In den Comic-Workshops haben sich die Frauen dann kurze Geschichten aus dem Leben erzählt und sie gezeichnet. Als wir bspw. einmal über Spiele im Schulhof sprachen, bemerkten eine peruanische und eine persische Frau, dass sie das gleiche Spiel kennen. Neben Unterschieden zeigten sich bei aller Vielfalt auch immer überraschend irgendwelche Parallelen.
KBD: Neben der Interkulturalität habt ihr aber noch anderes angestrebt.
NZ: Wir wollten nicht nur Frauen unterschiedlicher Nationalitäten einladen, sondern uns auch allen sozialen Schichten öffnen – wir hatten Staatsanwältinnen und Ärztinnen, genauso wie Analphabetinnen, also tatsächlich eine sehr große Bandbreite. Und es sind auch deutsche Frauen dabei gewesen, denn ganz wichtig ist uns dabei die Integration.
KBD: Vom Workshop zum Buch, ein langer Weg?
NZ: Oh ja, vor allem die Finanzierung war äußerst schwierig, denn auch wenn die Stadt von der Idee begeistert war, so kam doch nur wenig finanzielle Unterstützung. Aber erst mal zurück zum Anfang: Die Idee zum Buch kam mir mit den „Good night stories for rebel girls“, einem Band, den meine Schwester aus Italien meinen Töchtern schenkte. Da sind 100 Lebensläufe von Frauen aus aller Welt von 100 unterschiedlichen Illustratorinnen begleitet. So kam ich auf die Idee, ein sehr spezifisches Dresdner Buch zu machen. Ich wollte damit auch auf die besondere Situation dieser Stadt, die sehr gespalten ist, reagieren. Neben wahren Geschichten ging es mir auch um unterschiedliche Stile.
KBD: Die Autorinnen sind also die Teilnehmerinnen der Kurse und dann gibt es da die gezeichneten Bilder, die auch von unterschiedlichen Illustratorinnen stammen?
NZ: Ja, mir war wichtig, dass es über eine Dokumentation raus geht und wirklich auch ein schönes Objek wird. Am Ende haben wir trotz Covid 74 Veranstaltungen in sechs Monaten gehabt. Über die ganze Stadt verteilt waren das Workshops, Atelierbesuche und vor allem die Tandem-Sitzungen, bei denen Autorinnen und Illustratorinnen dann zusammensaßen, Fotos aus der Kindheit anschauten und erzählten. Manchmal waren Übersetzer dabei. Insgesamt war ein Riesen-Netzwerk von Menschen beteiligt, was auch sehr viel Koordinationsarbeit einschloss.
KBD: Das Buch ist sogar in sieben unterschiedlichen Sprachen erschienen, denn neben der Muttersprache der Autorinnen gibt es natürlich immer auch den deutschen Text. Sieben Sprachen sprichst du auch selbst, habe ich gelesen. Mir scheint, das Buch ist in vielerlei Hinsicht wie ein Kulminationspunkt in deiner Laufbahn.
NZ: Ja, das trifft es wirklich, das ist es! Ein gutes Bild. Hier fließt vieles zusammen: das Soziale, das Politische – ich nutze es jetzt auch in der Politischen Bildung in Zusammenarbeit mit der TU Dresden. Aber natürlich auch das Künstlerische. Ich bekomme jetzt sehr viele Illustrationsaufträge, das ist ein Traum, den ich schon lange träume. Ich bekomme auch Aufträge für Workshops in politischer und kultureller Bildung mit Kindern und Erwachsenen, mit Schulen, mittlerweile in ganz Sachsen. Ich war innerhalb weniger Monate in Zittau, Dippoldiswalde, Bautzen und in Freital.
KBD: Wie ist es an anderen Orten? Erlebst du da einen Unterschied?
NZ: Nein, und das ist für mich eine sehr große Überraschung. Ich hatte z.B. einen Workshop an einer Schule in Dippoldiswalde und wurde einige Monate lang vorgewarnt: Achtung, hier gibt es in der Klasse Rechtsradikale, die werden dich stören. Aber das stimmte nicht. Alle, wirklich alle haben bis zum Ende mitgemacht und ihre Geschichte gezeichnet.
KBD: Das ist auch ein Workshop, in dem du mit Comics arbeitest?
NZ: Ja, wir arbeiten mit Comics und biographisch. Ich erzähle Geschichten aus dem Comicbuch, die Jugendlichen erzählen mir von sich und durch die Comics ist da schon etwas Jugendliches, das sehr verbindend ist. Dabei mache ich alles aus dem Bauch raus, habe aber durch die 10jährige Erfahrung kleine Tricks wie etwa persönliche Geschichten über Mobbing und Diskriminierung in Obst- und Gemüsegeschichten umzuwandeln. Das schafft ein bisschen Distanz, das anonymisiert und macht es leichter, die schweren Dinge zu erzählen.
KBD: Am Ende hast du es also geschafft, dass sich dir auch die angeblich schwierigen Jugendlichen öffnen?
NZ: Auch wenn es nicht immer idyllisch ist, ich bin jedes Mal positiver zurückgekehrt und so oft überrascht worden, weil die Jugendlichen sich mir geöffnet haben.
KBD: Nazanin, mit dem Förderpreis ausgezeichnet zu werden, beinhaltet nicht nur Anerkennung. Es schließt auch den Wunsch der Stadt ein, das kulturelle Schaffen der Geförderten möge die Stadt weiterhin bereichern. Wie sieht es mit deinen eigenen Wünschen aus?
NZ: Es war für mich eine große Überraschung, ich habe nicht damit gerechnet. Jetzt kommt es ganz langsam bei mir an, und trotzdem bin ich zwiegespalten. Denn als projektbezogen Arbeitende bleibe ich gefühlt immer in der Rolle einer Bittstellerin, der man mit gefühlter Großzügigkeit etwas gibt. Wir sind aber leider immer noch unterbezahlt und können nicht von unserer Arbeit leben.
Was nicht heißt, dass ich die Projektarbeit nicht liebe. Ich liebe sie sogar sehr. Auch das Arbeiten im Team. Ich liebe den sozialen Aspekt des Interkulturellen und es gefällt mir, dass ich meine sieben Sprachen verwenden konnte. Aber mir fehlt gerade sehr meine eigene künstlerische Sprache. Seit Jahren rede ich mit mir selbst nicht mehr, finde keine Zeit, an der Staffelei zu malen – ohne Auftrag. Das wünsche ich mir sehr, dafür wieder Zeit zu haben.
Interview und Foto: Christine Gruler
* Stimmen. 47 Geschichten von Dresdner Frauen aus aller Welt in Wort und Bild. Hrsg. von Nazanin Zandi und Elena Pagel, Sandstein Verlag , 2021